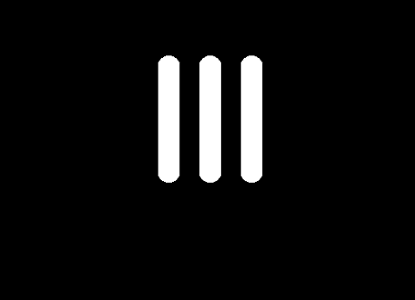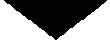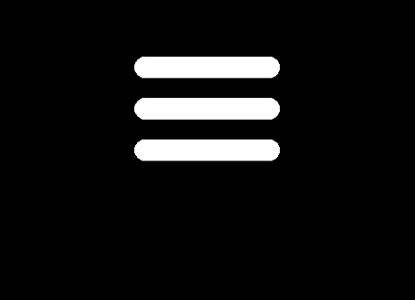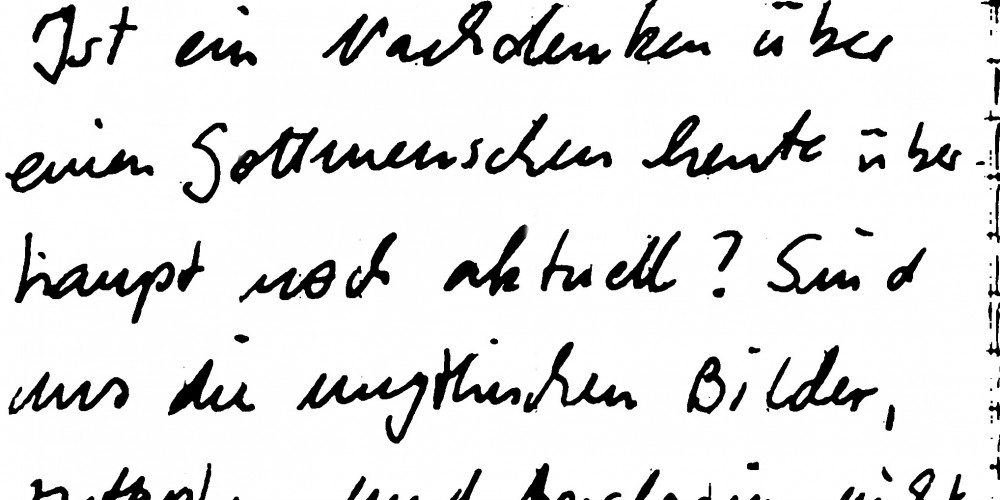
Eine kurios-philosophische Suche nach dem Gottmenschen
Eine kurios-philosophische Suche nach dem Gottmenschen
Klappentext:
Alexander Graeff dringt an unbequemen Lücken in die abendländische Kulturgeschichte ein und zeigt, dass es nicht-duale Vorstellungen von Gott und der Welt genauso gegeben hat wie die dualen, die descartschen.
Gewiss sind diese Vorstellungen marginal, aber sie können gerufen werden! Denn Graeff philosophiert nicht nur, er meditiert, ruft herab und heraus: Sein Geist ist die Figur des Gottmenschen, den niemand wirklich zu kennen scheint und doch aus den allzu klaffenden Lücken abendländischer Kultur herausstarrt. Graeffs literarischer Blick auf diese Figur ist schief, surreal, doch die Ergebnisse höchst zukunftsfähig!
Das philosophische Buch hat sich die „unentscheidbaren Fragen“ zum Thema gewählt. Betriebsam kurios, aber dennoch den Blick für lebensweltliche Anknüpfung nicht verlierend, fragt „Dazwischen“ nach Immanenz und Transzendenz:
Kann Gott tägliche Routine werden?
Ist Okkultismus wieder en vogue?
Wann ist es legitim, sich Gottmensch zu nennen?
Wie finden die Satyrn zurück zu Dionysos?
U.v.m.
Aus dem Buch:
Vorwort
Wenn wir akribisch beobachten, suchen und forschen, bei gleichzeitiger Akzeptanz ausgeloteter Grenzen; unser Tun immer und immer wieder reflektieren, dann können wir durch die hieraus resultierende Veränderung unserer Mentalität auch andere Zustände erreichen: Wenn wir es schaffen, das vielgestaltige Leben nicht als voneinander unabhängige Versionen aufzufassen, kann langfristig Menschsein vielleicht mit anderen Zuschreibungen versehen werden.
Nur wer schweigt, kann nicht angegriffen werden.
Suum cuique!
Dieses Buch ist dem Gottmenschen gewidmet. Man könnte es auch überschreiben mit: Meditation über die Bedeutung des Begriffes „Gottmensch“. Der zusammengesetzte Begriff „Gottmensch“ ist ein Zwitter. Seine Gestalt folgt einem Prinzip, das ich Dazwischen nennen möchte.
Nichts liegt mir ferner, bereits zu Beginn des Buches mit der These einer möglichen Existenz dieses Gottmenschen aufzuwarten. Ich werde zwar nach Konkretisierungen des Begriffes fragen – und auch Antworten geben –, möchte aber nicht schon in der Einleitung mit der Tür ins Haus fallen.
Meine Methode ist die Meditation. Mit Meditation meine ich die Vertiefung in den Begriff, denn über die Sprache scheint mir erst ein Zugang zu konkreten Bewusstseinsinhalten möglich. Bewusstsein, Meditation, Gott, Mensch, alle diese Begriffe sind Orientierungsbojen im sprachlichen Meer, durch das ich die M.S. Dazwischen navigiere. Ich bin der Kapitän – aber ohne Mannschaft. Ich muss alles selbst tun: Navigieren und Deckschrubben, und ich muss mit mir selbst den Mastkorb besetzen. Denn hier oben blicke ich bis an die Grenze des Horizonts.
Was ist das aber für eine Figur, der wir hier die Aufmerksamkeit schenken? Wer oder was kann Gegenstand einer Meditation sein? Und, viel wichtiger: Gibt es stellvertretend für den Begriff „Gottmensch“ ein Wesen aus Fleisch und Blut?
Nicht auf alle Fragen, die uns während der Meditation begegnen, werde ich Antworten anbieten können. Dies nicht, weil ich meinen Leserinnen und Lesern etwas vorenthalten möchte, vielmehr gibt es Fragen, die nicht entscheidend beantwortet werden können. Unentscheidbare Fragen.
Bleibt der Gottmensch also ein reines Abstraktum, nur eine Denkfigur? Oder sollten wir, neben aller Ausflüge in Kulturgeschichte und Philosophie, etwa zeigen können, dass der Gottmensch doch eine lebendige Persona beinhalten könnte? Wollen wir das zeigen? –
Betrachten wir zum Beispiel meinen russischen Namensvetter, Komponisten und Pianisten Alexander Skrjabin (1872-1915). Aus seinem künstlerischen Werk springt uns ein Widergänger entgegen: der Gottmensch. Für Skrjabin war Gottmenschsein kein künstlerisches Thema allein, sondern elementares Prinzip seines gesamten Weltbildes. Im eigenen Individuationsprozess näherte er sich diesem Prinzip an. Immer wieder – unversehens – tauchte die Synthese von Gott und Mensch in seinem Leben und Werk auf. Dabei durchlief Skrjabin eine Entwicklung: vom gläubigen Christenmensch, zum nietzscheanischen Übermensch, bis hin zum selbst kreierten Gottmensch. Ganz gleich welche metaphysische Überlegung er gerade anstellte, immer war das Menschsein die wesentliche Konstante seiner Überlegungen zur Gottesidee. Für ihn war der Mensch Gegenstand einer Verbindung verschiedener, transzendenter, also die Grenzen des eigenen Bewusstseins übersteigender, Erfahrungen und innerer Bilder. Vor allem faszinierte ihn das Schöpferische an der Gottesidee. Für Skrjabin stand fest, dass es der Mensch war, der die schöpferische Leistung an allen Gotteskonstruktionen erbrachte.
Alexander Skrjabin war hiervon derart überzeugt, dass er sogar behauptete, allein mit Hilfe seines Willens trockenen Fußes einen See überqueren zu können. Auch seine Überzeugungskraft muß groß gewesen sein: den anstehenden Beweis seiner behaupteten Seebegehung redete er den anwesenden Zweiflern einfach aus.
Was war er also, dieser Alexander Skrjabin? Ein klavierspielender Gottmensch, der zu jung an einer Blutvergiftung starb? Man könnte skeptisch vermerken: Wo war Skrjabins angeblich gottmenschliche Kraft als er sie brauchte, um gesund zu werden? Wo war sein eiserner Wille, der seine Gebrechen hätte verschwinden lassen können?
Zu einfach? Aber: Ja. Wir sollten uns frei machen von der Vorstellung, dass Gottmenschen unsterblich, unbesiegbar und allwissend sind. Vielmehr dient es dem Verständnis meiner Überlegung, sich an die Halbgötter der antiken Mythen zu erinnern: halb Mensch waren sie, verletzlich und sterblich.
Ist ein Nachdenken über die Figur des Gottmenschen überhaupt zeitgemäß? Sind uns die mythischen Bilder, Metaphern und Analogien aus der Antike nicht längst verloren gegangen? Und mutet es nicht sonderbar an, wenn ein moderner Mensch mittleren Alters über die scheinbar obsoleten Figuren alter Autoritäten nachdenkt? Sind die mythischen Bilder heute nicht längst in den Sachgesetzlichkeiten unserer volltechnisierten Leistungsgesellschaft erstickt worden?
Durch pragmatische Nüchternheit und dem durch Wissenschaft untermauerten Begriff der Realität scheinen Bilder wie die des Gottmenschen längst entmythisiert. Ich denke aber, dass genau diese Bilder und Begriffe auch heute dabei helfen könnten, uns selbst besser kennenzulernen.
Meine Meditation, die durch und durch eine kuriose Suche ist, soll nicht als (frei-)zeitfüllende Technologie beschrieben werden, sondern als Suchbewegung, die ein bisschen mehr Integrität anstrebt als die gängigen Übungen unserer hektischen Zeit; letztlich ist sie eine Suche nach dem Selbst, die ohne Lebenshilfefirlefanz versucht, ein sich selbst abhanden gekommenes Selbst introspektiv auf sich selbst zurückzuführen.
Nicht alle Bilder und Begriffe sind für diese Selbstsuche geeignet. Die Freiheit der selbstbestimmten Wahl aber, eine urmenschliche Kompetenz, die sich seit der Epoche, die wir Moderne nennen, von bestimmten religiösen und kulturellen Formen löste, bietet sich für unsere Selbstsuche an. Wir werden nämlich auf die Fähigkeit zurückgreifen, Bilder und Begriffe am hier behandelten Gegenstand – ein Erkenntnisgegenstand – abzuwägen und zuvor nur ganz bestimmte Bilder und Begriffe gewählt zu haben. Diese Freiheit der Wahl ist Ausdruck einer elementaren, subjektiven Wesenheit, die uns durch die Metaphern und Analogien metaphorischer Sphären als Individuen – interessant macht! Der Begriff wirft sich förmlich auf unser Selbst zurück; in der Denkbemühung um mythologische Vorstellungen erfüllen wir unser Subjekt mit diesen mythologischen Vorstellungen, leben den Mythos noch einmal. Die mythischen Bilder, die pathetischen Begriffe und archaischen Mythen begegnen uns dann auch im (post)modernen Denken und Handeln. Ihr Antlitz hat sich verändert, gewiss, aber ihre Funktion ist keinesfalls obsolet. Solange wir uns als bildsam offene Wesen entwickeln und lernen, solange wir in der Welt dem fremden Anderen begegnen, solange wir lieben, streiten, streben und das alles zu reflektieren wissen, wirft unser Denken und Handeln kaum sichtbare Anker aus in das Meer der Analogien, Bilder und Metaphern; nur deshalb können wir auch für noch so nüchterne Begebenheiten unbekannte, längst vergessene Welten aktivieren, die nirgends sonst als in uns selbst schlummern.
Nachdenken über den Gottmensch ist folglich ein Analogienfinden, ein zwangloses Spiel mit den mythischen Begriffen und wohl auch das Verdichten einiger philosophischer Überlegungen zu einer bewegenden Metapher. Die Metapher des Gottmenschen also, die Trägerin der delikatesten Attribute ist, wird unserer Menschlichkeit gerecht; sie erinnert Unvollkommenheit und Endlichkeit, sie verweist auf unser Menschsein.
Der Gottmensch ist Mensch. Nicht nur weil er das Wort „Mensch“ im Namen führt, sondern weil die ideale Vorstellung des Begriffes ihre lebenskonkrete Dimension, die immer auch Beschränkung ist, durchaus verlieren kann.
Wenn wir Gott im Himmel verorten, ist Gott wirklich tot, wie es Nietzsche prophezeite. Gott als Idee dagegen lebt solange, wie es Menschen gibt. An uns ist es, diese Idee auf die Erde herunter zu holen, zu konkretisieren, und ihr somit eine lebenskonkrete Dimension zu verleihen. Immanuel Kant wusste das so auszudrücken: „Eine Idee ist nichts anderes, als der Begriff von einer Vollkommenheit, die sich in der Erfahrung noch nicht vorfindet.“ Die intelligible Dimension dieser Vollkommenheit macht das Wesen der Idee aus (in Rein- und Zwitterform). So gesehen lebt Gott doch, denn eins hat sein Begriff mit dem des Menschen gemein: seine Idee. Kant hebt dieses „noch“ hervor und fragt weiter: „Ist sie [die Idee] deswegen unmöglich?“
Ideen sind nicht vergänglich, sie bestehen unabhängig von ihrer Konkretisierung durch Denkbemühungen, sie bestehen aber nicht unabhängig von irgendeiner Denkbemühung. Manchmal trotzen sie dem Tod.
Dem vorzeitigen Absterben von Konkretisierungen zuvor intelligibler Ideen will ich mit Dazwischen wenigsten ein Stück weit entgegenwirken. Und so wandelt sich der Wille, über Wasser gehen zu wollen: Der Mensch wird in einer bestimmten Idee zu dem, was man als Gottmensch beschreiben könnte. Doch von welcher Art ist diese Idee? Im Wesentlichen bricht sie mit der dualen Vorstellung eines voneinander getrennten Immanenten und Transzendenten, mit der zementierten Grenze zwischen Welt- und Himmelreich, zwischen Mensch und Gott. Weder soll nur das eine, noch das andere vor dem jeweils opponierenden Anderen zurückbleiben. Es soll auch nicht gesondert auf tradierte Absichten Bezug genommen werden. Vielmehr scheint es vonnöten, das Prinzip holistisch, poetisch und synkretistisch zu begreifen, als ein Ganzes. Und ein solches Prinzip nenne ich: Dazwischen.
Institutionelle Religion verdeckt durch ihre einfache (meist duale) Kodierung den Blick des Gläubigen auf eben dieses Ganze. Moderne Religionen haben meist nicht nur Gott und Endlichkeit zum Thema, sondern trennen allzu oft das subjektive Band zwischen den Gläubigen und ihrem Gott. Durch obsolete Normen, Anempfehlungen und unverstandene Riten wird so den Gläubigen die Chance genommen, ihren Gott verstehen zu können, Gott erfahren zu können, ja vielleicht selbst Gott zu werden. Gottmenschen dagegen haben sich dieses subjektive Band bewusst gemacht, sie sind die modernen Priester ihres privaten Tempels – ihres Leibes –, denn nur der Leib vermittelt die Tatsache der Endlichkeit, er gibt der Idee des Gottmenschseins erst Sinn. Durch die Medialität des Leibes aber können die Ideen erst konkretisiert werden. Der Gottmensch benötigt keine unverstandenen Riten und Normen, keine unzureichenden Schnittstellen, keine Priester und Vermittler. Und keine Unsterblichkeit!
Die Teile und das Ganze wären nämlich sinnlos, wenn wir unsterblich wären. Das, was wir Leben nennen, hörte auf der Stelle auf. Würden wir ewig leben, gäbe es keine Ideen, die wir uns von Gott und dem Menschen machen könnten, es gäbe keine Unterscheidungen, keine spielerischen Vorstellungen eines Gottmenschen, alles wäre uns gleich(gültig). Etwa so wie dem zu Unsterblichkeit gelangten Raymond Fosca, eine Figur in Simone de Beauvoirs Roman „Alle Menschen sind sterblich“, ein schöpferisches Leben verwährt bleibt, wozu er sterblich sein müsste. Stattdessen kämpft Fosca unentwegt mit der Gleichgültigkeit, und nur die Nähe zum Anderen – in seinem Fall die (sterbliche) Schauspielerin Regine – bringt ihn ansatzweise an das Leben eines Sterblichen heran. Wären wir unsterblich, verlören wir unsere Kreativität. Auch Fosca kann nicht kreativ sein. Er selbst drückt das so aus: „Ich lebe und habe kein Leben. Ich bin niemand.“ Als Unsterbliche wäre uns ein kreativer Umgang mit Begriffen gar nicht möglich, kein Sinn würde hieraus erwachsen.
Die Idee des Gottmenschen ist manifest, pragmatisch. Sie scheint eng gebunden zu sein an unsere anthropologische Verfasstheit. Der Mensch, ein Wesen aus Fleisch und Blut, ist Träger der Ideen; ohne seine subjektive Leistung der Ideengenerierung gäbe es weder Begriffe noch Transzendenz.
Ich erachte es für ein ethisches Miteinander für geradezu notwendig, die Annahme zu treffen, dass der Mensch aber nicht nur leibliches Wesen ist, sondern auch ein von geistigen Dispositionen konstituiertes. Ein Wesen, aus dem die artenreichsten Ideen erfolgen können. Ich nenne es bewusst eine ethische Forderung, das Subjekt nicht allein auf seine leibliche Existenz zu reduzieren. Der Unterschied zwischen Subjekt und leblosem Objekt würde verwischt werden. Kultur ist Ausdruck des menschlichen Geistes. Das andere Subjekt, mein Gegenüber, ist Teil dieses Geistes, weil es auch Teil der Kultur ist. Würde man Menschen behandeln wie Objekte, sie also auf ihre reine Materialität reduzieren, würde man sein Gegenüber benutzen, wie man Objekte benutzt.
Das Durchwandern der Welt des ethischen Miteinanders ist eine zweite Forderung, die an Leiblichkeit und Geistigkeit gestellt werden kann. Ideen generieren kann nur, wer beständig fragt und sich neugierig dem Fremden stellt. Die Fähigkeit des Menschen, nach Belieben in unterschiedlichen Welten zu wandern, ist die Grundvoraussetzung für ein ethisches Zusammenleben, denn nur auf diesen Wanderungen kann der Mensch der Welt des fremden Anderen begegnen, und lernen, sich in das Selbst der fremden Welt hineinzuversetzen. Wird dagegen Sesshaftigkeit kultiviert, weiß der Mensch mit dem Anderen nicht mehr zusammen zu kommen; er fühlt sich ohnmächtig gegenüber dessen Fremdheit, bekommt schließlich Angst und entwickelt gar Groll auf das Fremde.
Der Mensch strebt danach, seine reine Leiblichkeit zu transzendieren, seinen Ideen, die dem Geist entspringen auch zu folgen, sie zu konkretisieren. Der Mensch kann niemals eins werden mit seiner spezifischen Form als Mensch; immer wandert er weiter, folgt dem Bedürfnis, auch andere Ichs annehmen zu können. Menschliches Zusammenleben wird undenkbar, wenn Menschsein in anonymem Kollektivismus oder solipsistischem Individualismus erstickt wird, wenn das fremde Andere und somit die eigene Kultur ausgeklammert wurde.
Bei aller Vorrede haben wir noch nicht geklärt, weshalb man überhaupt über einen Begriff wie den des Gottmenschen meditiert und noch dazu ein Buch darüber schreibt. Ich bin geneigt, meinen Überlegungen einen knappen, aber wichtigen Gedankengang vorweg zu schicken: Weshalb erachte ich es für reizvoll, ein Dazwischen zu konzipieren?
Mich beschleicht gelegentlich das Gefühl von extremer Bodenhaftung. Ausgelöst wird dieses Gefühl durch verschiedene Faktoren: durch Erziehung, Sozialisation und durch mein Umfeld. Mit diesem Gefühl bin ich nicht allein in der Welt. Auf dem Weg in die geistigen Gefilde liegen häufig Steine. Manchmal baut sich sogar ein ganzes Gebirge vor einem auf. Das Ideelle scheint mir allzu oft abgekoppelt vom alltäglichen Leben. Wir bemühen uns nicht mehr um tiefemotionale Erfahrungen, suchen nicht nach geistiger Erbauung, sondern geben uns ausschließlich den schnellen, fassbaren Freuden hin. Wir leben in einer Welt der zementierten Dualität, der unüberwindbaren Denkschablonen. Alles ist von Stereotypen durchzogen, die unser Denken begrenzen; und eine Befreiung von Grenzen kann häufig nur als hilflose Kompensation mit gleichbedeutender Stereotypie erfahren werden.
Die Vorstellung eines Dazwischens ist der Versuch einer Auflösung dualer Vorstellungen, wie Gott/Mensch, Transzendenz/Immanenz, Innen/Außen, Selbst/Anderes, Gut/Böse, Mann/Frau usw. Ich will versuchen, ein dialektisches Motiv der Auflösung von Stereotypen in die vorliegende Meditation mit einfließen zu lassen, ohne mir Vollständigkeit und exakte Berechnung vorzunehmen.
Vielleicht gelingt es mir, den Fluch dualer Kodierung aufzubrechen und mich mittels fließender Prosa einer Bewusstheit anzunähern, die bezwecken könnte, Gräben und Grenzen zu überschreiten. Diversität macht diese Grenzen erst deutlich, doch ist sie zugleich ein chancenreiches Momente von Welt und Selbst: Sie ist das Fundament, auf dem ein Mehr von Welt und Selbst errichtet werden kann. Die Auflösung stereotyper Vorstellungen soll in meinem Versuch prosaisch vonstatten gehen, denn Prosa ist ein integrales Fluidum, welches mit der Literatur Welt und Selbst verschmelzt. Und ich tue das alles wohl nicht zuletzt auch um der eigenen Reflexion willen: um das fremde Andere, das Unbekannte, ja das zuvor Verborgene zu lüften.

Eine kurios-philosophische Suche nach dem Gottmenschen
Klappentext:
Alexander Graeff dringt an unbequemen Lücken in die abendländische Kulturgeschichte ein und zeigt, dass es nicht-duale Vorstellungen von Gott und der Welt genauso gegeben hat wie die dualen, die descartschen.
Gewiss sind diese Vorstellungen marginal, aber sie können gerufen werden! Denn Graeff philosophiert nicht nur, er meditiert, ruft herab und heraus: Sein Geist ist die Figur des Gottmenschen, den niemand wirklich zu kennen scheint und doch aus den allzu klaffenden Lücken abendländischer Kultur herausstarrt. Graeffs literarischer Blick auf diese Figur ist schief, surreal, doch die Ergebnisse höchst zukunftsfähig!
Das philosophische Buch hat sich die „unentscheidbaren Fragen“ zum Thema gewählt. Betriebsam kurios, aber dennoch den Blick für lebensweltliche Anknüpfung nicht verlierend, fragt „Dazwischen“ nach Immanenz und Transzendenz:
Kann Gott tägliche Routine werden?
Ist Okkultismus wieder en vogue?
Wann ist es legitim, sich Gottmensch zu nennen?
Wie finden die Satyrn zurück zu Dionysos?
U.v.m.
Aus dem Buch:
Vorwort
Wenn wir akribisch beobachten, suchen und forschen, bei gleichzeitiger Akzeptanz ausgeloteter Grenzen; unser Tun immer und immer wieder reflektieren, dann können wir durch die hieraus resultierende Veränderung unserer Mentalität auch andere Zustände erreichen: Wenn wir es schaffen, das vielgestaltige Leben nicht als voneinander unabhängige Versionen aufzufassen, kann langfristig Menschsein vielleicht mit anderen Zuschreibungen versehen werden.
Nur wer schweigt, kann nicht angegriffen werden.
Suum cuique!
Dieses Buch ist dem Gottmenschen gewidmet. Man könnte es auch überschreiben mit: Meditation über die Bedeutung des Begriffes „Gottmensch“. Der zusammengesetzte Begriff „Gottmensch“ ist ein Zwitter. Seine Gestalt folgt einem Prinzip, das ich Dazwischen nennen möchte.
Nichts liegt mir ferner, bereits zu Beginn des Buches mit der These einer möglichen Existenz dieses Gottmenschen aufzuwarten. Ich werde zwar nach Konkretisierungen des Begriffes fragen – und auch Antworten geben –, möchte aber nicht schon in der Einleitung mit der Tür ins Haus fallen.
Meine Methode ist die Meditation. Mit Meditation meine ich die Vertiefung in den Begriff, denn über die Sprache scheint mir erst ein Zugang zu konkreten Bewusstseinsinhalten möglich. Bewusstsein, Meditation, Gott, Mensch, alle diese Begriffe sind Orientierungsbojen im sprachlichen Meer, durch das ich die M.S. Dazwischen navigiere. Ich bin der Kapitän – aber ohne Mannschaft. Ich muss alles selbst tun: Navigieren und Deckschrubben, und ich muss mit mir selbst den Mastkorb besetzen. Denn hier oben blicke ich bis an die Grenze des Horizonts.
Was ist das aber für eine Figur, der wir hier die Aufmerksamkeit schenken? Wer oder was kann Gegenstand einer Meditation sein? Und, viel wichtiger: Gibt es stellvertretend für den Begriff „Gottmensch“ ein Wesen aus Fleisch und Blut?
Nicht auf alle Fragen, die uns während der Meditation begegnen, werde ich Antworten anbieten können. Dies nicht, weil ich meinen Leserinnen und Lesern etwas vorenthalten möchte, vielmehr gibt es Fragen, die nicht entscheidend beantwortet werden können. Unentscheidbare Fragen.
Bleibt der Gottmensch also ein reines Abstraktum, nur eine Denkfigur? Oder sollten wir, neben aller Ausflüge in Kulturgeschichte und Philosophie, etwa zeigen können, dass der Gottmensch doch eine lebendige Persona beinhalten könnte? Wollen wir das zeigen? –
Betrachten wir zum Beispiel meinen russischen Namensvetter, Komponisten und Pianisten Alexander Skrjabin (1872-1915). Aus seinem künstlerischen Werk springt uns ein Widergänger entgegen: der Gottmensch. Für Skrjabin war Gottmenschsein kein künstlerisches Thema allein, sondern elementares Prinzip seines gesamten Weltbildes. Im eigenen Individuationsprozess näherte er sich diesem Prinzip an. Immer wieder – unversehens – tauchte die Synthese von Gott und Mensch in seinem Leben und Werk auf. Dabei durchlief Skrjabin eine Entwicklung: vom gläubigen Christenmensch, zum nietzscheanischen Übermensch, bis hin zum selbst kreierten Gottmensch. Ganz gleich welche metaphysische Überlegung er gerade anstellte, immer war das Menschsein die wesentliche Konstante seiner Überlegungen zur Gottesidee. Für ihn war der Mensch Gegenstand einer Verbindung verschiedener, transzendenter, also die Grenzen des eigenen Bewusstseins übersteigender, Erfahrungen und innerer Bilder. Vor allem faszinierte ihn das Schöpferische an der Gottesidee. Für Skrjabin stand fest, dass es der Mensch war, der die schöpferische Leistung an allen Gotteskonstruktionen erbrachte.
Alexander Skrjabin war hiervon derart überzeugt, dass er sogar behauptete, allein mit Hilfe seines Willens trockenen Fußes einen See überqueren zu können. Auch seine Überzeugungskraft muß groß gewesen sein: den anstehenden Beweis seiner behaupteten Seebegehung redete er den anwesenden Zweiflern einfach aus.
Was war er also, dieser Alexander Skrjabin? Ein klavierspielender Gottmensch, der zu jung an einer Blutvergiftung starb? Man könnte skeptisch vermerken: Wo war Skrjabins angeblich gottmenschliche Kraft als er sie brauchte, um gesund zu werden? Wo war sein eiserner Wille, der seine Gebrechen hätte verschwinden lassen können?
Zu einfach? Aber: Ja. Wir sollten uns frei machen von der Vorstellung, dass Gottmenschen unsterblich, unbesiegbar und allwissend sind. Vielmehr dient es dem Verständnis meiner Überlegung, sich an die Halbgötter der antiken Mythen zu erinnern: halb Mensch waren sie, verletzlich und sterblich.
Ist ein Nachdenken über die Figur des Gottmenschen überhaupt zeitgemäß? Sind uns die mythischen Bilder, Metaphern und Analogien aus der Antike nicht längst verloren gegangen? Und mutet es nicht sonderbar an, wenn ein moderner Mensch mittleren Alters über die scheinbar obsoleten Figuren alter Autoritäten nachdenkt? Sind die mythischen Bilder heute nicht längst in den Sachgesetzlichkeiten unserer volltechnisierten Leistungsgesellschaft erstickt worden?
Durch pragmatische Nüchternheit und dem durch Wissenschaft untermauerten Begriff der Realität scheinen Bilder wie die des Gottmenschen längst entmythisiert. Ich denke aber, dass genau diese Bilder und Begriffe auch heute dabei helfen könnten, uns selbst besser kennenzulernen.
Meine Meditation, die durch und durch eine kuriose Suche ist, soll nicht als (frei-)zeitfüllende Technologie beschrieben werden, sondern als Suchbewegung, die ein bisschen mehr Integrität anstrebt als die gängigen Übungen unserer hektischen Zeit; letztlich ist sie eine Suche nach dem Selbst, die ohne Lebenshilfefirlefanz versucht, ein sich selbst abhanden gekommenes Selbst introspektiv auf sich selbst zurückzuführen.
Nicht alle Bilder und Begriffe sind für diese Selbstsuche geeignet. Die Freiheit der selbstbestimmten Wahl aber, eine urmenschliche Kompetenz, die sich seit der Epoche, die wir Moderne nennen, von bestimmten religiösen und kulturellen Formen löste, bietet sich für unsere Selbstsuche an. Wir werden nämlich auf die Fähigkeit zurückgreifen, Bilder und Begriffe am hier behandelten Gegenstand – ein Erkenntnisgegenstand – abzuwägen und zuvor nur ganz bestimmte Bilder und Begriffe gewählt zu haben. Diese Freiheit der Wahl ist Ausdruck einer elementaren, subjektiven Wesenheit, die uns durch die Metaphern und Analogien metaphorischer Sphären als Individuen – interessant macht! Der Begriff wirft sich förmlich auf unser Selbst zurück; in der Denkbemühung um mythologische Vorstellungen erfüllen wir unser Subjekt mit diesen mythologischen Vorstellungen, leben den Mythos noch einmal. Die mythischen Bilder, die pathetischen Begriffe und archaischen Mythen begegnen uns dann auch im (post)modernen Denken und Handeln. Ihr Antlitz hat sich verändert, gewiss, aber ihre Funktion ist keinesfalls obsolet. Solange wir uns als bildsam offene Wesen entwickeln und lernen, solange wir in der Welt dem fremden Anderen begegnen, solange wir lieben, streiten, streben und das alles zu reflektieren wissen, wirft unser Denken und Handeln kaum sichtbare Anker aus in das Meer der Analogien, Bilder und Metaphern; nur deshalb können wir auch für noch so nüchterne Begebenheiten unbekannte, längst vergessene Welten aktivieren, die nirgends sonst als in uns selbst schlummern.
Nachdenken über den Gottmensch ist folglich ein Analogienfinden, ein zwangloses Spiel mit den mythischen Begriffen und wohl auch das Verdichten einiger philosophischer Überlegungen zu einer bewegenden Metapher. Die Metapher des Gottmenschen also, die Trägerin der delikatesten Attribute ist, wird unserer Menschlichkeit gerecht; sie erinnert Unvollkommenheit und Endlichkeit, sie verweist auf unser Menschsein.
Der Gottmensch ist Mensch. Nicht nur weil er das Wort „Mensch“ im Namen führt, sondern weil die ideale Vorstellung des Begriffes ihre lebenskonkrete Dimension, die immer auch Beschränkung ist, durchaus verlieren kann.
Wenn wir Gott im Himmel verorten, ist Gott wirklich tot, wie es Nietzsche prophezeite. Gott als Idee dagegen lebt solange, wie es Menschen gibt. An uns ist es, diese Idee auf die Erde herunter zu holen, zu konkretisieren, und ihr somit eine lebenskonkrete Dimension zu verleihen. Immanuel Kant wusste das so auszudrücken: „Eine Idee ist nichts anderes, als der Begriff von einer Vollkommenheit, die sich in der Erfahrung noch nicht vorfindet.“ Die intelligible Dimension dieser Vollkommenheit macht das Wesen der Idee aus (in Rein- und Zwitterform). So gesehen lebt Gott doch, denn eins hat sein Begriff mit dem des Menschen gemein: seine Idee. Kant hebt dieses „noch“ hervor und fragt weiter: „Ist sie [die Idee] deswegen unmöglich?“
Ideen sind nicht vergänglich, sie bestehen unabhängig von ihrer Konkretisierung durch Denkbemühungen, sie bestehen aber nicht unabhängig von irgendeiner Denkbemühung. Manchmal trotzen sie dem Tod.
Dem vorzeitigen Absterben von Konkretisierungen zuvor intelligibler Ideen will ich mit Dazwischen wenigsten ein Stück weit entgegenwirken. Und so wandelt sich der Wille, über Wasser gehen zu wollen: Der Mensch wird in einer bestimmten Idee zu dem, was man als Gottmensch beschreiben könnte. Doch von welcher Art ist diese Idee? Im Wesentlichen bricht sie mit der dualen Vorstellung eines voneinander getrennten Immanenten und Transzendenten, mit der zementierten Grenze zwischen Welt- und Himmelreich, zwischen Mensch und Gott. Weder soll nur das eine, noch das andere vor dem jeweils opponierenden Anderen zurückbleiben. Es soll auch nicht gesondert auf tradierte Absichten Bezug genommen werden. Vielmehr scheint es vonnöten, das Prinzip holistisch, poetisch und synkretistisch zu begreifen, als ein Ganzes. Und ein solches Prinzip nenne ich: Dazwischen.
Institutionelle Religion verdeckt durch ihre einfache (meist duale) Kodierung den Blick des Gläubigen auf eben dieses Ganze. Moderne Religionen haben meist nicht nur Gott und Endlichkeit zum Thema, sondern trennen allzu oft das subjektive Band zwischen den Gläubigen und ihrem Gott. Durch obsolete Normen, Anempfehlungen und unverstandene Riten wird so den Gläubigen die Chance genommen, ihren Gott verstehen zu können, Gott erfahren zu können, ja vielleicht selbst Gott zu werden. Gottmenschen dagegen haben sich dieses subjektive Band bewusst gemacht, sie sind die modernen Priester ihres privaten Tempels – ihres Leibes –, denn nur der Leib vermittelt die Tatsache der Endlichkeit, er gibt der Idee des Gottmenschseins erst Sinn. Durch die Medialität des Leibes aber können die Ideen erst konkretisiert werden. Der Gottmensch benötigt keine unverstandenen Riten und Normen, keine unzureichenden Schnittstellen, keine Priester und Vermittler. Und keine Unsterblichkeit!
Die Teile und das Ganze wären nämlich sinnlos, wenn wir unsterblich wären. Das, was wir Leben nennen, hörte auf der Stelle auf. Würden wir ewig leben, gäbe es keine Ideen, die wir uns von Gott und dem Menschen machen könnten, es gäbe keine Unterscheidungen, keine spielerischen Vorstellungen eines Gottmenschen, alles wäre uns gleich(gültig). Etwa so wie dem zu Unsterblichkeit gelangten Raymond Fosca, eine Figur in Simone de Beauvoirs Roman „Alle Menschen sind sterblich“, ein schöpferisches Leben verwährt bleibt, wozu er sterblich sein müsste. Stattdessen kämpft Fosca unentwegt mit der Gleichgültigkeit, und nur die Nähe zum Anderen – in seinem Fall die (sterbliche) Schauspielerin Regine – bringt ihn ansatzweise an das Leben eines Sterblichen heran. Wären wir unsterblich, verlören wir unsere Kreativität. Auch Fosca kann nicht kreativ sein. Er selbst drückt das so aus: „Ich lebe und habe kein Leben. Ich bin niemand.“ Als Unsterbliche wäre uns ein kreativer Umgang mit Begriffen gar nicht möglich, kein Sinn würde hieraus erwachsen.
Die Idee des Gottmenschen ist manifest, pragmatisch. Sie scheint eng gebunden zu sein an unsere anthropologische Verfasstheit. Der Mensch, ein Wesen aus Fleisch und Blut, ist Träger der Ideen; ohne seine subjektive Leistung der Ideengenerierung gäbe es weder Begriffe noch Transzendenz.
Ich erachte es für ein ethisches Miteinander für geradezu notwendig, die Annahme zu treffen, dass der Mensch aber nicht nur leibliches Wesen ist, sondern auch ein von geistigen Dispositionen konstituiertes. Ein Wesen, aus dem die artenreichsten Ideen erfolgen können. Ich nenne es bewusst eine ethische Forderung, das Subjekt nicht allein auf seine leibliche Existenz zu reduzieren. Der Unterschied zwischen Subjekt und leblosem Objekt würde verwischt werden. Kultur ist Ausdruck des menschlichen Geistes. Das andere Subjekt, mein Gegenüber, ist Teil dieses Geistes, weil es auch Teil der Kultur ist. Würde man Menschen behandeln wie Objekte, sie also auf ihre reine Materialität reduzieren, würde man sein Gegenüber benutzen, wie man Objekte benutzt.
Das Durchwandern der Welt des ethischen Miteinanders ist eine zweite Forderung, die an Leiblichkeit und Geistigkeit gestellt werden kann. Ideen generieren kann nur, wer beständig fragt und sich neugierig dem Fremden stellt. Die Fähigkeit des Menschen, nach Belieben in unterschiedlichen Welten zu wandern, ist die Grundvoraussetzung für ein ethisches Zusammenleben, denn nur auf diesen Wanderungen kann der Mensch der Welt des fremden Anderen begegnen, und lernen, sich in das Selbst der fremden Welt hineinzuversetzen. Wird dagegen Sesshaftigkeit kultiviert, weiß der Mensch mit dem Anderen nicht mehr zusammen zu kommen; er fühlt sich ohnmächtig gegenüber dessen Fremdheit, bekommt schließlich Angst und entwickelt gar Groll auf das Fremde.
Der Mensch strebt danach, seine reine Leiblichkeit zu transzendieren, seinen Ideen, die dem Geist entspringen auch zu folgen, sie zu konkretisieren. Der Mensch kann niemals eins werden mit seiner spezifischen Form als Mensch; immer wandert er weiter, folgt dem Bedürfnis, auch andere Ichs annehmen zu können. Menschliches Zusammenleben wird undenkbar, wenn Menschsein in anonymem Kollektivismus oder solipsistischem Individualismus erstickt wird, wenn das fremde Andere und somit die eigene Kultur ausgeklammert wurde.
Bei aller Vorrede haben wir noch nicht geklärt, weshalb man überhaupt über einen Begriff wie den des Gottmenschen meditiert und noch dazu ein Buch darüber schreibt. Ich bin geneigt, meinen Überlegungen einen knappen, aber wichtigen Gedankengang vorweg zu schicken: Weshalb erachte ich es für reizvoll, ein Dazwischen zu konzipieren?
Mich beschleicht gelegentlich das Gefühl von extremer Bodenhaftung. Ausgelöst wird dieses Gefühl durch verschiedene Faktoren: durch Erziehung, Sozialisation und durch mein Umfeld. Mit diesem Gefühl bin ich nicht allein in der Welt. Auf dem Weg in die geistigen Gefilde liegen häufig Steine. Manchmal baut sich sogar ein ganzes Gebirge vor einem auf. Das Ideelle scheint mir allzu oft abgekoppelt vom alltäglichen Leben. Wir bemühen uns nicht mehr um tiefemotionale Erfahrungen, suchen nicht nach geistiger Erbauung, sondern geben uns ausschließlich den schnellen, fassbaren Freuden hin. Wir leben in einer Welt der zementierten Dualität, der unüberwindbaren Denkschablonen. Alles ist von Stereotypen durchzogen, die unser Denken begrenzen; und eine Befreiung von Grenzen kann häufig nur als hilflose Kompensation mit gleichbedeutender Stereotypie erfahren werden.
Die Vorstellung eines Dazwischens ist der Versuch einer Auflösung dualer Vorstellungen, wie Gott/Mensch, Transzendenz/Immanenz, Innen/Außen, Selbst/Anderes, Gut/Böse, Mann/Frau usw. Ich will versuchen, ein dialektisches Motiv der Auflösung von Stereotypen in die vorliegende Meditation mit einfließen zu lassen, ohne mir Vollständigkeit und exakte Berechnung vorzunehmen.
Vielleicht gelingt es mir, den Fluch dualer Kodierung aufzubrechen und mich mittels fließender Prosa einer Bewusstheit anzunähern, die bezwecken könnte, Gräben und Grenzen zu überschreiten. Diversität macht diese Grenzen erst deutlich, doch ist sie zugleich ein chancenreiches Momente von Welt und Selbst: Sie ist das Fundament, auf dem ein Mehr von Welt und Selbst errichtet werden kann. Die Auflösung stereotyper Vorstellungen soll in meinem Versuch prosaisch vonstatten gehen, denn Prosa ist ein integrales Fluidum, welches mit der Literatur Welt und Selbst verschmelzt. Und ich tue das alles wohl nicht zuletzt auch um der eigenen Reflexion willen: um das fremde Andere, das Unbekannte, ja das zuvor Verborgene zu lüften.